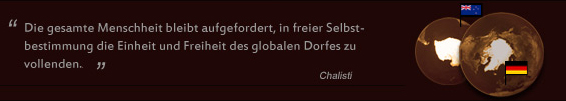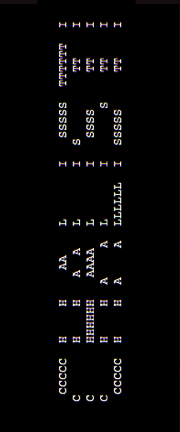Eine neue Verantwortung in der Informatik ?
Von der Reimplementation der Technokratie durch Moral
Zunaechst koennte man meinen, dass dann eben neben
den Werten der Freiheit und der Gleichheit auch
noch reine Luft und reines Wasser, Baeume und
Tiere wertekatalogfaehig werden; und da es ohne-
hin nur um Listen geht, koennte man beliebig er-
weitern: Pandas, Tamilen,
Frauen... . Das waere je-
doch, langfristig und Muss da nicht zwangslaeufig
aufs Grundsaetzliche ge- das Pendel zugunsten jener
sehen, eine zu einfache ausschlagen, die erst so
Auskunft. richtig aufbluehen, wenn
sich die Situation verkom-
Niklas Luhmann, pliziert?
Oekologische Kommu-
nikation John Brunner,
Der Schockwellenreiter
Die Computertechnologie schreitet voran. Niemandem
wird es gelingen, sich der Informatik-Zivilisation zu ent-
ziehen. Bestenfalls koennte jemand den Kontinent verlassen,
um sich in die letzten verbliebenen Urwaelder zurueckzuziehen.
Da solches Tun nur fuer die wenigsten vorstellbar ist, kommt
es darauf an, den Urhebern informationstechnischer Loesungen
ein Bewusstsein davon zu vermitteln, was ihr Konstruieren
ueber die blosse Technik hinaus bewirkt. Innerhalb der Wissen-
schaft von der Informatik gibt es gegenwaertig eine Reihe von
klugen Personen, die sich mit den Konsequenzen ihres Fachs
beschaeftigen. Ob die Auseinandersetzung breitere Kreise
innerhalb der Disziplin erreichen wird sei dahingestellt.
Jedenfalls besteht die Gefahr, dass vermeintlich neue Denk-
weisen nur das wiederherstellen, was sie selbst als Uebel
erkannt haben: die reine Technokratie.
Der grosse Teil dieses bisher also beschraenkten Perso-
nenkreises gehoert einer Generation an, die entscheidende
Eindruecke ihres Lebens vor mehr als zwanzig Jahren aufgenom-
men hat. Damals war der (universitaere) Zeitgeist von diffu-
sen Traeumen des Sozialismus gepraegt, wie es sich die nach-
gewachsene Generation kaum vorstellen kann. Wer heute (wie
der Autor) als Mittzwanziger zum Beispiel eine Fernsehdoku-
mentation ueber diese Zeit ansieht und etwa mit dem morali-
schen Pathos eines langatmigen und irgendwie verblendeten
Rudolf Dutschke (1940-1979) konfrontiert ist, der sitzt mit
dem offenen Mund des Staunens da und kann nicht glauben, dass
es sich bei diesen fotografischen und magnetischen Aufzeich-
nungen um Geschehnisse handelt, die Realitaet waren und
praegenden Einfluss auf die Elterngeneration hatten.
Nun ist nicht zu bestreiten, dass es der Zeit um "Acht-
undsechzig" zu verdanken ist, dass sich der menschliche Um-
gang deutlich entkrampft hat. Wenn ein Beamter heute einen
Knopf im Ohr oder einen Stoppelbart tragen kann, dann gehen
solche und viele andere Entwicklungen sicher auf diese Zeit
zurueck und koennen zu einem guten Teil als Verdienst der
damals jungen Generation angesehen werden. Zwang und Enge
der fuenfziger Jahre, die sich damals aufzuloesen begannen,
sind fuer junge Menschen heute kaum noch vorstellbar.
------ Die Rede ist von Tugenden.
Nun sind die Institutionen-Marschierer von damals
laengst angekommen. Sie haben ihre grossen und unerreichbaren
Plaene aufgegeben und erinnern sich sentimental an die
damalige Zeit. Was sie aber nicht aufgegeben haben sind
ihre Denkweisen. Diese wirken als Rudimente fort und koennten
angesichts der heute absehbaren Probleme durch die Anwendung
der Informations- und Kommunikationstechniken einmal mehr in
die Sackgasse fuehren.
Die Informatik beginnt auf inneren und aeusseren Druck
zu entdecken, dass in ihrem Tun eine Verantwortung steckt,
die sie bisher zuwenig wahrgenommen hat. Nun schreitet der
Einsatz von Computertechnik jedoch schnell voran - es werden
taeglich neue Einsatzmoeglichkeiten entdeckt, und die Systeme
selbst entwickeln einen Grad der Komplexitaet, der fuer den
Menschen nicht mehr ueberschaubar ist. Die moeglicherweise
katastrophalen Folgen sind kaum absehbar. Angesichts solcher
Zustaende nimmt es nicht Wunder, dass sich auch unter Informa-
tikern Ratlosigkeit ausbreitet. Die Frage nach der Verant-
wortung wird entweder ignoriert oder oftmals mit hilflosen
Forderungen nach einer neuen Moral beantwortet. Man koenne
der Probleme nur Herr werden, wenn der Techniker sich ueber
sein Tun klar wird und selbiges nur an dem orientiert, was
fuer den Menschen als Wert wuenschenswert ist.
Nun liegt darin aber eine doppelte Problematik. Sollte
man sich hinreissen lassen, einen Wertekodex definieren zu
wollen, so stellt sich die Frage, wer ueber ihn zu bestimmen
habe. Richtlinien von Standesorganisationen koennen sich
Entscheidungen ueber gesamtgesellschaftliche Fragen nicht
anmassen. Bliebe also die Loesung ueber politische Vorgaben,
wie sie sich vielleicht in Analogie zu den bekannten
Grenzwerten der Umweltgesetzgebung entwickeln liessen. Doch
neben der Schwierigkeit einer Operationalisierung (In wel-
cher Einheit sollte man den Grad des informationstechnischen
Wissens-, Anwendungs- und Folgenstandes messen?) gaebe es das
offensichtliche Problem der Ueberforderung von Politikern,
die sich schon lauthals als Experten preisen lassen, wenn
sie die Funktion einer Enter-Taste begriffen haben.
Der zweite Aspekt der Doppelproblematik liegt im Wesen
von Moral. Innerhalb der Informatik ist (zunaechst von
wenigen vorsichtigen Stimmen) die Forderung nach "Geboten"
zu hoeren, und es wird gar von der Notwendigkeit neuer
Tugenden gesprochen. Was sich aus solchen Vorstellungen
ergeben kann, klingt schon in den Begriffen an. Den Extrem-
fall sehen wir exemplarisch in Buechners Robespierre, wenn er
fordert, dass die Tugend durch den Schrecken herrschen muesse.
Wo Vorstellungen von Moral Eingang in das Denken ueber
elementare Dinge finden, verlieren Werte wie Freiheit und
Menschenwuerde. Denn Tugenden kennen keine Toleranz; sie sind
an glaeubigen Gehorsam gewoehnt. Fuer individuelle Ideen der
Problemloesung oder neue Vorschlaege wird dann kein Platz mehr
sein.
Aber das Dilemma setzt sich noch fort. Zunaechst mag
man eintretenden Schaeden noch mit Hilfe des "Versicherungs-
tricks" begegnen. Eine Haftpflichtversicherung fuer den
Betrieb von Computersystemen kann eventuelle Schaeden schnell
finanziell ausgleichen. Doch die Tragfaehigkeit eines solchen
Systems wird schnell schwinden. Denn die Informationstechnik
ist von dem Drang zu immer groesseren Strukturen gekennzeich-
net; Computernetze sind auf dem Vormarsch. Es entsteht also
eine neue Art von Grosstechnologie, deren Aussmass bestenfalls
mit denen der Chemie- oder Atomindustrie zu vergleichen ist.
Offenbar scheint also auch die Informatik in Gebiete vorzu-
stossen, wo die Beherrschbarkeit mit dem Hinweis auf fatale
Restrisiken relativiert werden muss. Es wird sich niemand
mehr finden, der solche Grossrisiken versichert.
------ Das Ergebnis ist Selbstberuhigung!
Moeglicherweise kuendigt sich als Reaktion derzeit schon
ein Trend an, der schliesslich irgendwelche technischen
Abstrakta zu "guten" bzw. "schlechten" Systemen erklaert.
Nach Art von Gesetzbuechern liesse sich dann entscheiden, ob
ein Informatiker oder ein Unternehmen seine Verantwortung im
jeweiligen Falle verletzt hat. Leider kann ein solches
Vorgehen nicht vor negativen Wirkungen der Informations-
technik schuetzen. Dies ist aus drei Gruenden so. Zunaechst ist
es eine alltaegliche Erfahrung, dass sich Personen von Taten
mit schaedlichen Folgen durch Strafen dann nicht zurueckhalten
lassen, wenn das mit Sanktionen belegte Tun ausgesprochen
lukrativ ist. Gerade die Informationstechnik wird auch in
Zukunft grosse wirtschaftliche Nutzenpotentiale beinhalten.
Zum Zweiten ist die Hemmschwelle fuer untugendhaftes Handeln
dann gering, wenn jemand davon ausgehen kann, dass ihm
fehlerhaftes Handeln kaum nachgewiesen werden kann. Wie etwa
sollte der Urheber und Emittent eines Computer-Virus ausfin-
dig gemacht werden?
Nun werden die Verfechter einer neuen Moral einwenden,
dass es nicht um Sanktionen gegen Personen geht, die bestimm-
ten Vorstellungen zuwiderhandeln, sondern vielmehr darum,
den Menschen ein Bewusstsein zu vermitteln, dass sie dazu
veranlasst, bestimmte Wertvorstellungen aus eigener Ueberzeu-
gung und Entscheidung zu vertreten. Gegen eine solche For-
derung ist zunaechst nichts einzuwenden, ja, sie muss sogar
begruesst werden, weil sie keinen unmittelbaren Zwang ausuebt
und somit der menschlichen Wuerde gerecht wird. Aber dennoch
muss deutlich gesagt werden, dass gerade aus dieser intrinsi-
schen Motivation der dritte und vielleicht beunruhigenste
Grund gegen die Wirksamkeit moralischen Bewusstseins er-
waechst. Es ist die menschliche Neigung zur selektiven Wahr-
nehmung der Welt - ein Phaenomen, das immer nur die anderen
betrifft, weil man es an sich selbst nicht bemerken kann.
Nehmen wir nur eines der zahlreichen banalen wie
grotesken Beispiele, die uns im Alltag begegnen. Die Tragik
des gewaehlten Falles liegt darin, dass gerade ein verantwor-
tungsbewusser Mensch in die Faenge psychischer Sperren geraet.
Stellen wir uns also einen klugen und liebenswerten Hoch-
schullehrer der Informatik vor. Sein Hauptanliegen ist unter
anderem die Oekologie: unsere natuerlichen Lebensgrundlagen
muessen wiederhergestellt werden, was auch zentrales Ziel
einer aufklaerenden Informatik sein muss. Er will zu einer
Tagung in einer entfernten Stadt. Und er entscheidet sich
nicht fuer die relativ umweltfreundliche Bahn, sondern be-
nutzt das Auto, weil es ja billiger sei...
Natuerlich ist ihm laengst bewusst, dass gerade das Auto
eine eklatante (und nicht nur umweltoekologische) Fehlent-
wicklung ist. Dennoch handelt er nicht nach seiner Erkennt-
nis. Es muss bei der Benutzung des eigenen Wagens offenbar
eine andere Fragestellung beruehrt sein! Legen wir uns auf
die Einsicht fest, dass diese Bewusstseinsspaltung einem
Menschen nicht zum Vorwurf zu machen ist, so wird erkennbar,
dass vorhandenes Wissen und bestimmte Wertvorstellungen keine
unmittelbare Funktionalitaet im Hinblick auf die Abwendung
von Schaeden hat. Die einzige Schlussfolgerung, die hier
bleibt, ist truebe. Moralisches Bewusstsein leistet fuer den
einen das, was dem anderen schon die Unwissenheit vermit-
telt: das reine Gewissen. Die Arbeit des Predigens und
Aufklaerens ueber die schlechten Dinge der Welt gewaehrt Ablass
und legitimiert das eigene unverantwortliche Tun.
Die Frage nach der Ueberwindung einer solchen Laehmung
draengt angesichts der Entstehung einer neuen Schluesseltech-
nologie, einer Technologie also, von der das Wohl und Wehe
unserer Zivilisation abhaengen wird. Nehmen wir den Einsatz
von Expertensystemen. Je komplexer sie werden, desto
geringer ist die Chance des Menschen, ihre Antworten zu
beurteilen. Die Beispiele sind hinlaenglich bekannt. Welcher
Arzt wird noch den Mut haben, sich gegen die Aussage eines
vielfach bewaehrten medizinischen Systems aufzulehnen. Denn
sollte die Ueberzeugung des Arztes nicht zum gewuenschten
Erfolg fuehren, so wird man ihn mit ernsten Konsequenzen
fragen, weshalb er nicht nach dem Rat des Systems gehandelt
habe. Nun kann man redundante Systeme vorschlagen, die
unabhaengig voneinander entwickelt werden und somit nicht
gleiche Fehler enthalten koennen. Doch wer wollte entschei-
den, welchem System bei unterschiedlichen Ergebnissen Ver-
trauen geschenkt werden soll? Es bleibt nur die Uebernahme
offenbar bewaehrter staatsphilosophischer Ueberlegungen: Las-
sen wir die Mehrheitsmeinung der Systeme entscheiden.
Bezeichnend ist, dass selbst die schaerfsten Kritiker
unsicherer informationstechnischer Systeme beginnen, elek-
tronisch gespeichertes Wissen fuer automatische Analysen zu
verwenden. Ihre Argumentation lautet, dass etwa angesichts
der aus unsicheren Betriebssystemen entstehenden Virenpro-
blematik keine andere Wahl bleibt, wenn man die auf solchen
Computern verarbeiteten Daten schuetzen will. Ist das ein
faustischer Pakt? Oder ist es Hilflosigkeit angesichts einer
explosionsartigen Verbreitung und Anwendung aeusserst unvoll-
kommener Computertechnik? Denn eine moegliche Folge ist allen
bewusst: Der Versuch einer provisorischen Gefahrenabwehr
fuehrt dazu, dass die Anwender meinen, sich nunmehr in
Sicherheit wiegen zu koennen.
------ Unwirksame Vorschlaege
Trotzdem darf sich kein Fatalismus ausbreiten. Dies
waere eine bedenkliche Reaktion auf Technik-Trends, deren
Weichen sich heute stellen. Doch es ist schwierig, Forderun-
gen zu finden, die Gefahren abwenden koennten. Und wenn man
sie formuliert, so erscheinen sie zu banal, als dass an ihre
Wirksamkeit geglaubt werden koennte. Denn unsere Sinne straeu-
ben sich, in kleinen Dingen Ursachen fuer umfassende Struktu-
ren zu sehen. Bei der Beobachtung der universitaeren Informa-
tik-Ausbildung faellt auf, dass die Studenten mit Lehrstoff
und Uebungsaufgaben ueberschwemmt werden. Wenn sie ihre Aufga-
ben bewaeltigen wollen, so sind sie zum Pfuschen gezwungen,
denn es bleibt kaum Zeit, ueber Problemloesungen eingehend
nachzudenken. Dies fuehrt zu einer Mentalitaet, die program-
miertechnischen Wildwuchs zutage foerdert. Die Appelle der
Lehrenden, einen gut dokumentierten und ueberschaubaren Ent-
wurf abzuliefern, muss da als Alibi-Absonderung im Winde
verhallen.
Unter den Studenten macht das Wort von der "experimen-
tellen Informatik" die Runde. Weil keine kompetenten An-
sprechpartner zur Verfuegung stehen, oder das schlechte
universitaere Klima es verbietet, stellen die Studenten ihre
Fragen kurzerhand an den Rechner, indem eine vermeintliche
Loesung einfach ausprobiert wird. Vermittelt der Augenschein
das richtige Funktionieren, so gilt das Experiment als ge-
glueckt. Auf das Verstaendnis fuer die Loesung und die Beurtei-
lung ihrer Tragfaehigkeit kommt es dann nicht mehr an. Und so
sind Nichtnachvollziehbarkeit und Fehleranfaelligkeit pro-
grammiert. Dies ist umso gefaehrlicher als eine Reflexion
ueber den Zweck eines Programms gar nicht angestellt wird.
Es fehlt also an etwas, dass man die Emanzipation des
Informatikers nennen koennte. Die Forderung wuerde lauten: Der
reine Techniker, der auf Vorgaben aus Politik und Wirtschaft
blind zu arbeiten beginnt, muss der Vergangenheit angehoeren,
wenn die grosstechnische Informatik nicht zur ernsthaften
Beeintraechtigung unseres Lebens werden soll. Informatiker
muessten sich ein Bewusstsein ueber die Konsequenzen ihrer
Technologie verschaffen. Doch bei naeherer Betrachtung ist
dieser Gedanke nicht unproblematisch. Eine reine Emanzi-
pation wuerde lediglich eine ausgeweitete Entscheidungs-
kompetenz derjenigen bedeuten, die eine informationstechni-
sche Ausbildung besitzen. Dabei besteht die Gefahr, dass
statt wirtschaftlichen oder sozialen Aspekten die techni-
schen staerker in den Vordergrund treten. Denn es laesst sich
sicher nicht leugnen, dass Informatiker zunaechst von rein
technischen Aspekten getrieben sind.
------ Mit dem Leitbild in die Katastrophe
Die Gefahr liegt also im reinen Ingenieur-Zustand des
Informatikers. Diesem entgegenzuwirken waere eine Grund-
voraussetzung, wenn man Hoffnungen in eine bessere Gefah-
renabwendung durch die Informatiker selbst setzt. Nun gibt
es in der eingangs genannten Personengruppe die Ueberzeugung,
dass es darauf ankomme, positive Leitbilder zu schaffen, an
denen sich Informationstechnik dann orientieren wuerde.
Solche Leitbilder koennten etwa bestimmte soziale Anforderun-
gen beinhalten. Die Hoffnung besteht darin, dass eine Vor-
stellung von erstrebenswerten Zustaenden den Informatikern
helfen koennte, Systeme zu schaffen, die dem Menschen gerecht
wuerden. Die Gefahr risikoreicher Technologie koennte somit
vermieden werden.
Die Erfahrung lehrt, dass diese Hoffnung truegt. Gerade
das Streben nach Verwirklichung grosser Zielvorstellungen,
wie Utopisten sie immer wieder in grossen Gemaelden der
Phantasie dargelegt haben, ist hochgefaehrlich. Es fuehrt in
Sackgassen. Denn wer euphorisch auf dem Weg ist, schaut auf
die Erfolge und vergleicht sie stolz mit der zu verwirk-
lichenden Idee. Einen Blick auf die zunaechst unbedeutend
erscheinenden negativen Nebenwirkungen gibt es nicht. Ein
eklatantes Beispiel fuer die fatalen Folgen der Verwirkli-
chung einer menschenfreundlichen Utopie sehen wir heute im
Automobil. Niemand konnte der Idee widersprechen, dass ein
Kraftwagen im Besitz eines jeden Haushaltes den Menschen aus
der Enge und Tristheit seiner eingeschraenkten Bewegungsmoeg-
lichkeiten befreien koennte. Der geplagte Stadtmensch wuerde
am Wochende hinaus in die frische und freie Natur aufbre-
chen. Menschen wuerden einander begegnen, weil sie mit dem
Automobil schneller beieinander sind.
Aber niemand konnte oder wollte die vielfaeltigen
Folgen sehen, die sich neben den positiven Leitvorstellungen
einstellen mussten (vgl. Chalisti vom 1. Juni 1991: "Wir
leben laengst im Cyberspace"). Heute haben wir die Pest in
den Staedten, und niemand kann einen Ausweg weisen, da der
individuelle Kraftverkehr laengst in die Gesamtzivilisation
eingebaut ist. Die vielfachen Abhaengigkeiten schaffen offen-
bar vollendete Tatsachen. Die zynische Antwort auf die
taegliche Beeintraechtigung des Lebens durch Laerm usw. sowie
die zehn- oder zwoelftausend zerquetschten und verkohlten
Todesopfer lautet: Es ist der Preis des Fortschritts.
Und genauso wird es mit der Informatik kommen. An
positiven und segensreichen Leitbildern fehlt es auch ihr
nicht, und das formulierte Ziel steht ganz analog zum
Strassenverkehr. Gefordert wird die "Gleichheit der Chancen
fuer die Welt der kognitiven Prozesse". Dies sei eine gewal-
tige Aufgabe, deren Umsetzung unter Umstaenden Jahrzehnte
dauern kann. So nebuloes die Forderungen bei genauerer
Betrachtung sind, so wahrscheinlich ist auch, dass eine
Sackgasse betreten wird. Das Bemuehen um ein im Gegensatz zu
amerikanischen Trends differenzierteres und durchdachteres
Leitbild mit moralischem Anspruch zeigt seine schlimmen
Folgen erst Generationen spaeter. Im Strassenverkehr haben wir
heute den Zustand, dass Kinder mit kiloschweren Rucksaecken -
Expeditionstraegern gleich - auf den mit toedlichen Gefahren
gepflasterten Schulweg geschickt werden. Derweil setzt sich
Papi in den tonnenschweren Wagen und brettert los zum
Arbeitsplatz. Unterwegs faehrt er hier und da an kleinen
Holzkreuzen und verwelkten Blumenstraeussen vorbei...
Fuer die Opfer der Computertechnik werden keine Pixel-
Kreuzchen auf den Bildschirmen erscheinen. Nun kaeme seitens
kritischer Informatiker folgender Einwand: Wenn uns gerade
durch die Informatik in der Zukunft Gefahren drohen, so waere
es doch unverantwortlich, wenn wir nicht wenigstens den
Versuch machen wuerden, positive Vorstellungen zu entwickeln.
Und in der Tat kann der Eindruck entstehen, dass die hier
unternommene Argumentation auf einen reinen Fatalismus oder
auf strikte Verweigerungshaltung gegenueber informationstech-
nischem Fortschritt hinauslaeuft. Dies aber muss als Irrtum
zurueckgewiesen werden. Hier geht es um die Warnung vor der
schleichenden Katastrophe, die mit den bisher vorgeschlage-
nen Mitteln nicht zu bekaempfen ist. Zwei Hauptgesichtspunkte
sind dabei zu beachten. Zunaechst darf nicht uebersehen
werden, dass Informationstechnik (wie viele andere Lebensbe-
reiche auch) der wirtschaftlichen Dynamik unterliegen.
Weiterhin muss in aller Deutlichkeit die Frage gestellt
werden, ob der Gestaltungswillen allein den Informatikern
ueberlassen werden darf.
Die Computer haben innerhalb der letzten zehn Jahre in
grossem Stil Einzug in die industrielle Fertigung gehalten.
Sie haben Logistik und Distribution revolutioniert sowie die
Arbeit in den Bueros veraendert. Es gibt also offensichtlich
deutliche Vorteile durch Rationalisierung. Vorteile ergeben
sich besonders aus dem Austausch von Informationen in einem
grossen System. Es reicht nicht, von der Abbildung bisheriger
Organisationsstrukturen auf Computer zu sprechen, denn deut-
lich vergroesserter und differenzierterer Informationsaustausch
oeffnet Tore zu ganz neuen Strukturen. Ohne hier eingehendere
Betrachtungen anstellen zu wollen, kann gesagt werden, dass
Informationstechnik zu umfassenden, grossraeumig vernetzten
Systemen fuehrt, deren Ueberschaubarkeit sich verringert. Die
oft gehoerte Forderung nach kleinen und nachvollziehbaren An-
wendungen liegt nicht im Wesen wirtschaftlicher Systeme.
------ Auf dem Weg zum Standesduenkel
Gleichzeitig werden Sicherungsmassnahmen aus Kosten-
oder strukturellen Gruenden nicht vorgenommen. Die Anwender
muessen sich auf ein bestimmtes System festlegen und koennen
anschliessend nicht ohne Weiteres umsteigen. Die Anbieter
versuchen ihrerseits die Gewinnmoeglichkeiten einer Technik
moeglichst lange auszunutzen. Erst wenn die Fehler der Sys-
teme unertraeglich werden, beginnt sich ein Markt fuer
Sicherheitstechnik zu entwickeln. Die Rolle der Prediger und
Warner ist aeusserst schwer einzuschaetzen. Die interessante
Frage lautet, inwieweit Bewusstsein unabhaengig von Kostenge-
sichtspunkten das Design bestimmen kann. Moeglicherweise sind
viele Kostenrechnungen von vornherein Makulatur und dienen
nur der Rechtfertigung einer Idee, die zunaechst nicht ratio-
nal begruendet werden koennte.
Aber gerade wenn Wahrheit heute beschlossen werden
muss, spielen Leitvorstellungen eine entscheidende Rolle.
Einfluss haette also derjenige, der in der Lage ist, bestimmte
Zielvorstellungen in die Ideenwelt der Verantwortungstraeger
zu befoerdern. Aber Einfluss bedeutet noch nicht die Macht zur
Gestaltung. Wenn Informatiker glauben, wuenschenswerte Tech-
nologien seien exakt planbar, so muss auf die Sozialwissen-
schaften verwiesen werden, die laengst eingesehen haben, dass
die Planbarkeit von umfassenden Idealvorstellungen aeusserst
gering ist.
Die Informatik ist eine vergleichsweise junge Wissen-
schaft. Sie beginnt Anstrengungen zu unternehmen, ihren
Platz zu finden. Dies wird durch den Umstand erschwert, dass
sie die Schluesseltechnologie unserer Zeit liefert und sich
somit grossen Erwartungen gegeuebersieht. Da Geld und Anerken-
nung winken, lohnt es fuer viele Informatiker nicht, Gedanken
an die Folgen zu verschwenden. Doch die Zweifel sind gewach-
sen. Es wird die Forderung laut, Informatiker muessten sich
staerker mit den vielfaeltigen sozialen Auswirkungen beschaef-
tigen, diese diskutieren und somit schon im Vorfeld Schwie-
rigkeiten entgegenwirken. Die Frage ist nunmehr, ob die
Informatik damit nicht ueberfordert ist.
In der oeffentlichen Meinung ist das Vertrauen in den
technischen Fortschritt ruecklaeufig. Es setzt sich die Ein-
sicht durch, dass fuer jede Entwicklung auch ein Preis zu
zahlen ist. Wahrscheinlich ist dieser Trend auch Ursache des
Auftauchens kritischer Fragen innerhalb der Informatik. Diese
auf den ersten Blick zu begruessende Entwicklung birgt aber die
Gefahr der drohenden (Selbst-)Isolation der Informatik. Es
ist geradezu ein Gemeinplatz, dass es in der Natur von Insti-
tutionen liegt, dass sie nur ueber bestimmte Schnittstellen mit
ihrer Umwelt in Kontakt treten. Wird ein neues Problem ueber-
haupt wahrgenommen, so erklaeren sie sich fuer nicht zustaendig,
oder es wird versucht, das Problem innerhalb des Systemrah-
mens zu loesen.
Und da liegt der heikle Punkt. Die Folgen der Einhal-
tung des Systemrahmens "Informatik" koennte zu einem neuarti-
gen Standesduenkel fuehren, indem man meint, alle Probleme
selbst loesen zu koennen. Da kaum zu vermuten ist, dass
naturwissenschaftlich ausgebildete Fachkraefte ein ausrei-
chendes Gespuer fuer soziale oder wirtschaftliche Frage-
stellungen entwickeln, bleibt die Forderung nach der Wahr-
nehmung von Verantwortung innerhalb der Informatik zweifel-
haft. Eine weitere Differenzierung und Spezialisierung
bestehender Institutionen erscheint heute ebenfalls unzurei-
chend. Denn ausschliessliche Fachbezogenheit von umfassenden
Gestaltungsvorstellungen bedeutet eine neue Form der Techno-
kratie. Dies waere eine Entwicklung, die nicht hingenommen
werden kann. Es kommt heute darauf an, neuartige gesell-
schaftliche Organisationsformen zu finden, welche den Pro-
blemen unserer fortschreitenden technischen Zivilisation
gerecht werden.
------ Die neue Moderne schaffen
Seit Mitte der siebziger Jahre haben sich Organi-
sationsformen herausgebildet, die unter dem Begriff "neue
soziale Bewegungen" zusammengefasst werden. Ihnen ist es
gelungen, vielfaeltigste Probleme und Fragestellungen in das
oeffentliche Bewusstsein zu transportieren. Der Vertrauens-
schwund des unausgereiften Btx-Systems etwa geht sicher
nicht zuletzt auf die spektakulaeren Aktivitaeten von Personen
zurueck, die diesen Bewegungen zuzurechnen sind. Ihnen ist es
gelungen, eine Kontrollfunktion wahrzunehmen, die anderen
Institutionen innerhalb der Gesellschaft offensichtlich
nicht zur Verfuegung stand. Es kann aber nicht uebersehen
werden, dass die neuen sozialen Bewegungen heute moeglicher-
weise an die Grenzen ihrer Leistungsfaehigkeit stossen, weil
oeffentliches Bekanntwerden von Missstaenden nicht ausreicht.
Blossgestellte Institutionen sind in der Lage, Schwaechen und
Fehler zu kaschieren bei gleichzeitiger Verbesserung der
Abschottung gegenueber Aussenstehenden.
Die zunehmende Komplexitaet und Verwobenheit techni-
scher und sozialer Zusammenhaenge erfordert neue Organisa-
tionsformen, welche die Isolation unterschiedlichster Insti-
tutionen aufhebt. Es bedarf eines offenen und fuer jeden
Interessierten zugaenglichen Forums, das Personen zunaechst
informell zusammenfuehren kann. Kommunikation, die - dem
Platzen einer Sporenkapsel gleich - auf das zufaellige
Erreichen passender Adressaten setzt, muss durch andere
Konzepte ergaenzt werden. Die Technik der Mailboxen bietet
die Moeglichkeit dazu. Doch waere es verfehlt, eine isolierte
Gegenkommunikation nach dem Muster von Presseagenturen auf-
bauen zu wollen. Diese Vorstellung zeigt sehr deutlich, dass
der technischen Ingenieurleistung der Bereitstellung von
Kommunikationssoftware noch keine angemessenen Ideen ueber
die ungeahnten Moeglichkeiten der Nutzung dieser neuen Tech-
nik gefolgt sind. Nur wenn unser Gemeinwesen eine verfei-
nerte und gleichzeitig uebergreifende Organisationskultur
entwickelt, wird sie den zukuenftigen Risiken der Computer-
Zivilisation einigermassen gewachsen sein. Dazu bedarf es der
Fantasie unterschiedlichster Menschen. Moralische Informati-
ker allein reichen keinesfalls!
Von Frank Moeller, Oktober 1991
F.MOELLER@LINK-HH.ZER
------------------------------------------------------------------------------